Es ist dreieinhalb Jahre her, um genau zu sein – als ausgewiesener Korinthenkacker sind wir da sehr genau. Da habe ich beschlossen, daß wir uns künftig auf ein Auto beschränken, ich dafür ein Pedelec bekomme und so blieb uns als vierrädriges Verkehrsmittel das Beschleunigungsmonster. Cookie und ich besitzen seitdem nur noch ein Auto. Präziser ausgedrückt: einen fahrtüchtigen Personenkraftwagen, mein Cabrio ist Cookies Bastelprojekt und wird nicht auf der Straße bewegt. Um Wege motorisiert von A nach B zurücklegen zu können, teilen wir uns seitdem meinen alten Corolla.
Und, wie ist es mir damit ergangen? Klappt das tatsächlich im Alltag? Werde ich nicht ständig naß, friere mir edle und nicht so edle Körperteile ab, verliere einen Haufen Zeit und überhaupt, ist dieses Fahrradding wirklich praktikabel? Die Antwort darauf ist nicht so einfach.
Denn ich bin nach wie vor ein bequemer Mensch. Gerade in der dunklen Jahreszeit gewinnt diese Bequemlichkeit gerne die Oberhand. Wer möchte sich schon zehn Minuten lang in möglichst viele Kleidungsschichten einpacken, um dann gerade mal fünfzehn Minuten zur Arbeit zu radeln? Da ist es viel einfacher, den Autoschlüssel zu nehmen und bequem ohne kalten Fahrtwind, Regen, Wetter immerhin trocken, wenn schon nicht warm, ins Büro zu fahren. Doch spätestens, wenn ich abends mit dem Auto nach Hause fahre, beginnt die Parade des Grauens: wenn ich Pech habe, fahre ich drei Mal um den Block, bis ich endlich einen Platz gefunden habe, um das Beschleunigungsmonster abzustellen. Die Parkplatz-Situation hat sich bei uns nicht verbessert, das Gegenteil ist der Fall.
Als Autofahrer am Verkehr teilnehmen macht nicht unbedingt mehr Spaß. Da wird über rote Ampeln geheizt, die Vorfahrt mißachtet, in den Kofferraum gekrochen, wenn ich es wage, tatsächlich die vorgeschriebenen 30 km/h zu fahren, wild gehupt, wenn man netterweise jemandem vom Parkplatz fahren läßt, weil die Ampel dreißig Meter die Straße hinunter ohnehin gerade rot ist, oder ich werde einfach mal mit achtzig Sachen überholt – auf der Gegenfahrbahn, inklusive Slalom um Verkehrsinseln. Habe ich den Wahnsinn unbeschadet überstanden und unser Beschleunigungsmonster abgestellt, bin ich im besten Falle genervt.
Mit dem Fahrrad brauche ich für die gleiche Strecke nur ein paar Minuten länger. Im Ganzen gesehen benötige ich häufig weniger Zeit, weil das sinnlose Um-den-Block-Gegurke auf der Suche nach einem Parkplatz entfällt. Mit dem Rad fahre ich auf den Hof, öffne die Garage, schiebe das Rad neben das Schwänchen und gut ist. Und mein zweirädriger Autoersatz hat einen weiteren, unschlagbaren Vorteil: ich verlasse abends das Büro und lasse die Arbeit dort. Es sind nur fünf Kilometer vom Büro bis ins heimische Mupfelheim, und ich habe mit Erstaunen feststellen können, wie sehr sich meine Laune unterscheidet, mit der ich zu Hause ankomme – und zwar abhängig vom gewählten Verkehrsmittel.
In die Pedale treten macht meinen Kopf frei. Ich bewege mich, ich habe frische Luft, und die Sinne nehmen die Umgebung intensiver wahr. Diese fünfzehn Minuten helfen mir, gerade nach Feierabend, im wahrsten Sinne des Wortes herunterzufahren. Regen, Wind, kalte Finger? Das ist mir mittlerweile egal, ich werde lieber ein wenig naß und dafür klar im Kopf. Statt trocken und gestreßt den Feierabend zu beginnen.
So blöde ich den Spruch „Es gibt kein schlechtes Wetter, nur unpraktische Kleidung“ auch finde, er hat einen wahren Kern. Im Winter ziehe ich einfach meine Motorrad-Handschuhe an, um die Patschpfoten warm und trocken zu halten. Für Regenfahrten habe ich mir einen gelb-grünen Regenumhang gekauft, der mich größtenteils trocken hält. Zugegeben, ich sehe damit aus wie ein mißglücktes Experiment aus einem geheimen Militär-Labor – der mutierte Riesenpapagei oder so. In der dunklen Jahreszeit nutze ich reflektierende Armbänder, um besser gesehen zu werden. Und damit die Ohren nicht abfrieren, habe ich mir Mützen gestrickt, die unter den Helm passen.
Ich kann dank meiner Fahrradtaschen einen umfangreicheren Einkauf transportieren. Ehrlich, ich liebe die Dinger und bereue nicht einen Cent, den ich dafür ausgegeben habe. Die Taschen sind wesentlich geräumiger, als der erste Blick vermuten läßt, und im Alltag einfach praktisch. Auch wenn ich immer wieder irritirte Blicke bekomme, wenn ich mit dem Einkaufswagen neben dem Rad stehe und Lebensmittel-Tetris mit meiner Beute zu spielen scheine. Ich freue mich jedes Mal, wenn der Wahnsinn vor Feiertagen wieder Besitz von Supermarktkunden ergriffen hat, einfach mit meinem Rad an der Blechlawine vorbei zu radeln, die sich hupend auf den Parkplatz wälzt.
Natürlich gibt es Tage, an denen ich mich frage, warum ich mir das eigentlich antue. Das Auto ist doch auf den ersten Blick so viel bequemer. Ganz besonders, wenn der Regen waagerecht fällt und sich die Scheibenwischer der geparkten Autos mir mitleidig ihre Sympathien zuzuflüstern scheinen. Allerdings steht dann in der Nebenstraße wieder ein Müllwagen, hinter dem sich die SUV-Muttis stauen, und ich freue mich, daß ich mich elegant mit dem Rad an den Stadtpanzern vorbei schlängeln kann, statt mir städtische Angestellte bei der Verrichtung ihrer Arbeit zu Gemüte führen zu müssen. Ich sitze nicht im Mini-Stau, ich bin in Bewegung. Und dazu noch pünktlich im Büro. Ein ziemlich schöner Gedanke.
Bereue ich es, mein Auto und die Unabhängigkeit, die ich mit einem eigenen Wagen immer verbunden habe, aufgegeben zu haben? Nein. Ärgere ich mich häufiger über meine eigene Person, weil ich mir selber vormache, daß das Beschleunigungsmonster die bequemere und schnellere Lösung sei, um zur Arbeit oder zum Supermarkt zu kommen? Mit Sicherheit. Und trotzdem, ich würde mich auch heute noch wieder dafür entscheiden, auf mein eigenes Auto zu verzichten beziehungsweise mir eins mit dem Mann zu teilen. In der Stadt brauche ich kein Auto. Das Einzige, was ich mir wirklich wünsche: vernünftige, breite und sichere Fahrradwege. Da gibt es in Gladbeck noch eine ganze Menge Luft nach oben.
Dreieinhalb Jahre später bin ich zwar nicht perfekt, dafür lasse ich das Auto häufiger stehen, nutze stattdessen das Rad und habe einen bewußteren Umgang mit dem Autofahren in der Stadt. Ich spare die Kosten für einen zweiten PKW, ich spare Sprit, und manchmal, wenn die Faulheit siegt, dann schimpfe ich sachte mit mir und steige den nächsten Tag geläutert wieder aufs Rad. Oder den übernächsten. Mobilität ist keine Frage der Anzahl der Reifen oder des Antriebs, Geschwindigkeit, Parkplätze oder Komfort. Es ist eine Entscheidung. Jedes Mal aufs Neue.
Manchmal überlege ich, das Auto ganz abzuschaffen. Aber dann fällt mir ein, daß ich ja irgendwo mich selbst transportieren muß, wenn das Fahrrad mal schlapp machen sollte. Soweit, daß ich in diesem Falle zu Fuß gehen oder, oh Graus, gar Bus fahren würde? Nee, fühl ich jetzt nicht so. Da bleib ich lieber noch ein wenig Radfahrerin bevor ich auf Fußgängerin umsattle.
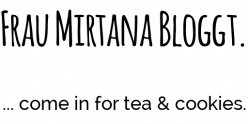

Ich habe seit dem 16.12.22 kein Auto mehr, nunmehr also gut 3 Jahre. Und ich muss sagen, das klappt ohne Probleme.
Ja, meine Freundin hat einen Kleinwagen, der natürlich praktisch ist, wenn man mal Cola Kisten kaufen kann. Aber zwischendurch hatten wir mehrere Monate kein Auto, als sie ihres gewechselt hat und auch das geht. Lebensmittel bringt und Hello Fresh und den Rest kaufe ich zu Fuß und mit Rucksack. Wenn mal Großeinkauf ansteht, kann man auch Picnic nutzen.
Ich wohne allerdings auch sehr günstig gelegen: Alle Supermärkte und Discounter sind Fußläufig erreichbar und für die wenigen Tage im Jahr, die ich ins Büro muss, kann ich den ebenfalls fußläufig erreichbaren Zug nehmen. Einziges Problem, das auch der Grund ist, warum wir das eine Auto noch behalten müssen, sind die längeren Sperren der Bahnlinie wegen des Betuwe-Ausbaus: Schienenersatzverkehr vom Niederrhein nach Düsseldorf ist keine ernst zu nehmende Alternative.
Währenddessen spare ich sehr viel Geld für Leasing, Versicherung, Wartung und Pflege und so weiter.
Natürlich steht dem „Autolos“ entgegen, dass zu Hause noch die Motorräder stehen. Die sind aber ja tatsächlich eher für Fun als Alltag und vor allem zum Reisen. Hier kompensiere ich das fehlende Auto übrigens über ein 1. Klasse-Ticket der Bahn , Uber und Mietwagen und komme in Summe immer noch billiger weg als mit einem eigenen PKW.
Ja, manchmal würde ich gerne einen kaufen. Weil technisch toll oder als Reisemobil oder einfach weil haben will. Aber brauchen? Brauchen tue ich kein Auto. Und was aufhört: Der BWLer in mir jammert nicht mehr die ganze Zeit herum, dass die laufenden Kosten anfallen, auch wenn das Auto mehr als 95% der Zeit rum steht.
Fazit: Ich brauche & wir brauchen kein Auto. Manchmal ist es bequemer, aber ein „müssen“ gibt es nicht. Seit dem bin ich aber sehr viel aufmerksamer, wie andere PKW-Führer*innen wie selbstverständlich die Stadt vereinnahmen. Und finde das zunehmend uncool.
(Meine zahlreichen Fahrräder habe ich natürlich unterschlagen. Aber das weißt Du ja 😀 )
Wenn ich alleine wäre, dann hätte ich den Wagen auch ganz abgegeben. Zur Not könnte ich mir unseren Pool-Firmenwagen leihen, wenn ich denn wirklich mal eines bräuchte. Und um schnell mal mittlere Strecken zu überbrücken kann ich auch das Motorrad nehmen.
Das Beschleunigungsmonster ist vorerst geblieben, weil der Mann im Außendienst arbeitet und von hier mit dem Zug zu fahren ist … einigen wir uns auf „abenteuerlich“. Gladbeck ist in der Hinsicht echt bescheiden angebunden. Abgesehen davon, Geräte für ein Großraumbüro mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu transportieren ist jetzt auch nicht so witzig.
Für die fünf Kilometer bis ins Büro bräuchte ich mit dem Bus gut vierzig Minuten, vorausgesetzt sie fahren pünktlich, weil ich mittendrin umsteigen muß – in der Zeit könnte ich den Weg besser laufen. Zumindest im Sommer, im Winter hätte ich Angst, daß mich die Autos auf dem Stück durch die Felder gnadenlos umnieten. Da fahre ich lieber mit dem Rad – auch wenn die PKW-Fahrer das Zeichen „Fahrradstraße“ nicht kapieren …
Das Beschleunigungsmonster ist halt ein altes Auto, günstig in der Versicherung und Wartung. Wobei ich durchaus erstaunt bin, daß ich auf langen Strecken nur um die 6,7 L/100 km mit dem 23 Jahre alten Auto brauche. Ich hatte schon Mietwagen, die bei gleicher Fahrweise wesentlich mehr Benzin verbraucht haben. So lange, wie mir mein Corolla nicht unterm Hintern weg rostet, bleibt er.
Ein Problem neuer Autos ist, dass sie nicht leichter und nicht windschlüpfriger werden. Und die Verbrenner sind weitgehend durchoptimiert – daher das mit dem Verbrauch:
Ich hatte mal einen Volvo mit 5-Zylinder Diesel: 6 Liter
Dann kam Downsizing + Mildhybrid. 4 Zylinder, aber +200KG für den E-Motor und die Batterie: 6 Liter Diesel
Das ist so absurd, dass einem nix mehr dazu einfällt. Übrigens auch nicht dazu, warum meine Motorrad bei sparsamer Fahrt immer noch 4-5 Liter Super auf 100km verbrennt – bei gerade mal etwas über 200KG Eigengewicht, verglichen mit den 1,8 Tonnen beim Volvo.
Meins verbraucht so ungefähr 4,5 l auf 100 km. Die ganze Chose wiegt mit mir und Gepäck allerdings weit mehr als nur 200 kg, allein das Moped hat schon 240. Und weder Moped noch ich sind das, was man als „windschnittig“ bezeichnen würde 😉
Ich hab mich vor einiger Zeit mal mit E-Motorrädern beschäftigt. Allerdings war das nicht sehr befriedigend. Entweder zu geringe Reichweite, die Dinger sahen aus wie eine Designstudie für ein Batmobil oder machten so einen filigranen Eindruck, daß ich mich gefragt habe, ob die mich überhaupt tragen können. Und das, was mir noch gefallen hätte, lag weit außerhalb meines Budgets.
Mein Motorradfahren bzw. -reisen entschuldige ich vor mir selber ja immer damit, daß ich nicht fliege 😛