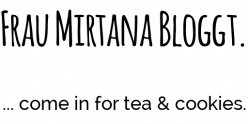… but I get up again.
Dieser winzige Moment, in dem mir innerhalb eines Wimpernschlags klar wird: „Fuck it, das war es!“ Noch bevor ich es wirklich begreifen kann, klatsche ich schon auf dem Asphalt auf. Ich rutsche nach links über die Gegenfahrbahn, während mein Motorrad an mir vorbeizieht, dem Straßenverlauf geradeaus folgend – auf der Seite liegend. Ein klassischer Anfängerfehler: Zu stark gebremst auf regennasser Straße. Das Vorderrad des Mopeds schmiert weg, und in Sekundenbruchteilen trennen sich unsere Wege.
Was genau passiert ist? Keine Ahnung. Habe ich vielleicht die aufgemalten Linksabbiegerpfeile erwischt? War es Dreck auf der Straße? Neuer Asphalt? Oder einfach nur Pech? Merkwürdig, da fahren wir über die schlimmsten Straßen – solche, die eher asphaltierten Feldwegen gleichen und deren Schlaglöcher groß genug für eine Poolparty wären – und nichts passiert. Und dann, auf einer gut ausgebauten Straße, legt es mich ausgerechnet auf der Linksabbiegerspur hin…

Fünf Kilometer vor dem Ziel. Unglaubliches Schwein gehabt, denn auf der Gegenfahrbahn war zum Glück niemand unterwegs. Und ich war nicht alleine. Mein Deauville-Kumpel pflückt mich erst von der Straße, überprüft, ob noch alles an mir dran ist, und hebt dann meine Maschine auf. Mir ist nichts passiert, abgesehen von den blauen Flecken, die die nächsten Tage meine linke Seite zieren und zusammen mit einem ordentlichen Muskelkater dafür sorgen werden, dass ich mich tagelang wie eine Achtzigjährige fühle. Möchte gar nicht wissen, wie ich ohne Schutzkleidung ausgesehen hätte … Und natürlich der Schreck. Das Schwänchen hat ein paar Blessuren abbekommen, aber nichts, was Cookie nicht wieder richten könnte.
Am nächsten Tag bin ich direkt wieder gefahren, zusammen mit meinem Deauville-Kumpel. Und zu allem Überfluss fängt es genau beim Start unserer ersten Tour durch den Westerwald an zu nieseln. Ich hätte am liebsten angefangen zu heulen. Bei jeder Kurve, vor allem bei den linken, hatte ich sofort wieder das Bild im Kopf, wie der Asphalt plötzlich ganz nah kommt… Der Schock saß mir noch tief in den Knochen, und das Fahren fühlte sich an, als würde ich eine Schrankwand bewegen. Es sah vermutlich auch so aus. Zwei, drei Touren hat es gebraucht, um das loszuwerden. Dachte ich.
Und dann stand der heiß ersehnte erste Urlaubstag vor der Türe. Wochenlang habe ich mich darauf gefreut, schließlich wollte ich wieder mit dem Motorrad die rund sechshundert Kilometer – gemessen ohne Umwege wegen der obligatorischen Baustellen und Straßensperrungen – in zwei Tagen bis zu unserem Urlaubsort im Kinzigtal fahren. Mit einem wachsamen Auge verfolgte ich die sich ständig ändernde Wetterprognose, bis endlich klar war: Freitag und Samstag wird gutes Wetter. Nicht zu warm, kein Regen, aber dafür Sonne. Perfekt.
Den Gedanken, dass ich dieses Mal ganz alleine unterwegs sein würde und dass auf meiner Route einige anspruchsvolle, aber eben auch wirklich einsame Strecken liegen, habe ich gekonnt verdrängt. Bis ich am Tag der Abfahrt auf dem Hof stehe und feststellen muss: Das neue Handy passt nicht in die Halterung am Motorrad. Weil zu groß. Der Gedanke, quer durch Deutschland zu fahren, ohne eine Karte vor Augen zu haben? Tja, der löst etwas in mir aus, womit ich nicht gerechnet habe.

Ich werde schlicht und ergreifend hysterisch. Anders kann ich das nicht nennen. Der arme Cookie steht daneben und versteht gar nicht, was passiert. So schlimm ist es doch nicht, oder? Steck das Handy einfach in die Brusttasche und lass dir die Navigation über den Helmfunk ansagen. In der Theorie eine gute Idee – wenn man links und rechts auseinanderhalten kann und nicht, wie ich, ständig beides verwechselt. Die Lösung des Problems dauert, und je später es wird, desto gestresster werde ich. Im Dunkeln unten in Ingelheim an meinem Hotel ankommen? Oder in der Dämmerung durch den teilweise ziemlich einsamen Taunus fahren? Das hatte ich mir anders vorgestellt.
Also sage ich dem Deauville-Kumpel ab, der mich eigentlich durchs Bergische Land begleiten wollte, und entscheide mich, wenigstens bis Köln über die Autobahn zu fahren, um die verlorene Zeit aufzuholen. Spoiler: Hat nicht geklappt. Zwischenzeitlich war ich Millisekunden davon entfernt, das Motorrad in die Garage zu schieben und am nächsten Tag mit Cookie im Auto in den Urlaub zu fahren. Scheiß doch aufs Moped fahren!

Über anderthalb Stunden später kann ich endlich losfahren. Mit der Navigation im Cockpit – aber im Gegensatz zu sonst, wo die Tiefenentspannung einsetzte, sobald ich mit dem Schwänchen vom Hof rollte, bin ich diesmal gestresst, verschwitzt und alles andere als entspannt. Die Armada von Blaulichtern, die vor mir auf die A2 auffährt, macht die Sache nicht besser. Freitags mittags über die A2 fahren, um Zeit zu sparen? Ja, es gibt definitiv intelligentere Pläne als diesen. Die Autobahn ist dicht, genauso wie alle Ausweichstrecken. Entweder Stau oder direkt gesperrt.
Und da stehe ich nun – genervt, gestresst und überlege ernsthaft, ob ich nicht doch umkehren und das Motorrad zurück in die Garage schieben soll. Doch dann gewinnt der sture Teil in mir die Oberhand, und ich fahre einfach los. Quer durch Essen, weiter nach Wuppertal und hinter Remscheid. Endlich bin ich im Bergischen Land. Die Straßen werden enger, die Ampeln weniger, die Kurven zahlreicher. Und ich?
Es braucht fast die gesamte Strecke, bis ich nicht mehr wie ein Anfänger über die Straßen rolle. Jede Kurve ist ein Kampf, von flüssigem Fahren kann keine Rede sein. Als ich nach mehr als dreihundert Kilometern am Hotel ankomme, merke ich, wie langsam die Anspannung aus meinen Schultern weicht. Beim Abendessen denke ich darüber nach, wie sehr der Sturz Ende Mai an meinem Sicherheitsgefühl genagt hat. Seitdem bin ich keine längeren Touren mehr allein gefahren, immer nur in Gesellschaft. Ich habe unterschätzt, wie anders es im Kopf ist, wenn man alleine unterwegs ist.

Aber am nächsten Tag geht es weiter. Und mit jedem der dreihundertsiebzig Kilometer kehren die Sicherheit und das Vertrauen in mich zurück. Bei schönstem Wetter gleiten das Schwänchen und ich wieder geschmeidig durch die Landschaft. Bergauf, bergab, um sanfte Kurven und enge Spitzkehren, vorbei an Straßensperrungen und Umleitungen. Und als der Kopf sich endlich entspannt, wird das Fahren wieder zu dem, was es sein sollte: Genuss und Spaß, statt Krampf.
Und die Moral der Geschichte? Den Kopf sollte ich beim Motorradfahren nicht unterschätzen. Ebenso wenig die Zeit, die ich brauche, um einen Sturz – egal, wie glimpflich er ausgegangen ist – zu verarbeiten. Früher oder später holt mich so eine Erfahrung wieder ein, schleicht sich aus dem Dunkel zurück, um mich genau dann in den Hintern zu beißen, wenn ich es am wenigsten gebrauchen kann.

Ende gut, alles gut.