Dieses uralte Lied, immerhin ist es von 1972, begleitet mich seit meiner Kindheit. Ein Überbleibsel der Zeit, die ich in der Kinder- und Jugendgruppe der Kirche verbracht habe. Schon als Kind hat dieser Text eine Saite in mir angeschlagen, ich habe die Melancholie darin geliebt. Nun ja, und als Teenager wurde die Melancholie ohnehin zu meinem zweiten Vornamen. Rilke lesende, ehemals Pubertierende anwesend? Einmal aufzeigen, bitte. Schön, herzlich Willkommen! Aber zurück zum Text. Herr Wader hat es geschafft, diesen Konflikt zwischen Sicherheit und Veränderung perfekt auf den Punkt zu bringen. Oder auf die Note.
Vor ein paar Tagen unterhielt ich mich mit jemandem, den ich lange nicht gesehen habe, über dieses Thema. Veränderung. Ich könne nicht gut damit umgehen, mich würde es nerven wenn sich ständig alles verändert, sagte ich. Und das im Brustton der Überzeugung, mir sei Veränderung ein Gräuel. Gleichzeitig stolperte ich gedanklich über diese Worte, kaum daß sie mir über die Lippen gekommen waren. Mir kam die Zeile „… und es ist mir längst klar … daß nichts bleibt … daß nichts bleibt, wie es war …“ in den Sinn und ich fragte mich plötzlich, was Veränderung für mich bedeutet.
Wie jetzt, ein Virus regiert die Welt?
Gerade verändert sich die Welt rasant, der freundliche Virus mit dem Krönchen macht es möglich. Sie wechselt so rasch ihre Farben, ich komme da nicht mehr mit. Was gestern noch wichtig war, hat heute schon keinen festen Grund mehr unter den Füßen. Und seitdem die Welt für mich um einen wichtigen Fixpunkt ärmer geworden ist, stehe ich ohnehin gefühlt auf dem Kopf. Nichts ist mehr, wie es mal war. Angeblich sollen wir uns irgendwann an eine „Neue Normalität“ gewöhnen. Merken tue ich davon noch nicht viel. Was ich hingegen merke, ist eine Menge Traurigkeit.
Denn Veränderung bedeutet auch Verlust.
Es gibt nicht nur die negativen Änderungen, die einem etwas nehmen. Das tun auch die Wechsel zum Guten. Trete ich einen neuen Job an, dann ist das erst mal nichts Schlechtes. Trotzdem lasse ich etwas zurück. Sei es der oder die eine besondere Kollegin, gemeinsame Mittagspausen oder bestimmte Routinen. Vielleicht nur den kürzeren Weg ins Büro. Heirat, Kinder kriegen, in eine schönere Wohnung oder ein Haus umziehen sind alles keine negativen Dinge, dennoch verlieren wir immer etwas dabei.
Die wenigsten Dinge, die jetzt nicht mehr so sind, wie sie mal waren, sind positiver Natur. Ja, mich nervt das Stück Stoff vor dem Gesicht auch und nein, ich zweifle deswegen noch lange nicht dessen Sinnhaftigkeit an. Ich kann das Wort mit „C“ nicht mehr hören. Mir fehlen Kinobesuche, unbeschwert Essen gehen ohne meine Kontaktdaten hinterlassen zu müssen, einfach so Freunde treffen ohne mir Gedanken über Ansteckungsrisiken zu machen und ich würde gerne wieder zum Frühschwimmen gehen. Drei Monate lang saßen die Kollegen im Home Office und das Haus war einfach viel zu ruhig ohne sie. Auch, wenn sie jetzt wieder da sind, es ist nicht alles wie vorher. Das freitägliche Ritual, zusammen zur Mittagspause zu fahren, gibt es nicht mehr. So viele Kleinigkeiten, die ich vorher als gegeben angesehen habe, jetzt sind sie weg und ihr Fehlen schmerzt.
Wir haben alle irgendwas verloren in dieser Welt verändernden Corona-Krise. Und Verlust macht traurig.
Veränderung bedroht den Status Quo.
Immer, wenn ich denke „Heureka, jetzt hab ich es!“ und der Meinung bin, ich hätte mein Leben einigermaßen im Griff und wüßte endlich, wie der Hase namens Status Quo läuft, kommen die Drehbuchschreiber meines Lebens daher und hauen mir meine Gewißheiten zu Klump. Dabei gehen dann jedes Mal die Dinge, die ich über mich selber zu wissen glaubte, zu Bruch und hinterlassen mir einen unschönen Haufen Scherben.
Ich mag den Status Quo. Einfach in Ruhe vor sich hin dümpeln empfinde ich als sehr erholsam und irgendwie gibt er mir ein Gefühl von Sicherheit. Veränderungen hingegen zwingen mich dazu, mich mit mir selber, meinem Leben, anderen Menschen, Beziehungen, Gefühlen, Verlust und weiß der Geier noch zu beschäftigen statt entspannt auf meinem sicheren Floß den Status Quo entlang zu dümpeln. Glaubenssätze neu definieren, Filter neu justieren und immer wieder auf einen neues mit der verdammten Feststellung, daß nichts im Leben wirklich sicher ist, konfrontiert zu werden. Ja, ich kann mich nach einer Zeit der Auflehnung, Wut, Trauer gut neu justieren. Ich mag es halt einfach nicht.
Wäre mal schön, wenn für eine Zeit einfach alles so bleibt, wie es war. Bin ja der Meinung, daß Darwins berühmtes „Survival of the fittest“ immer noch falsch übersetzt wird. Es heißt nicht „Überleben des Stärksten“ … Sondern „Überleben des Anpassungsfähigsten“. Was für Flora und Fauna gilt, das gilt auch für mein Seelenleben. Leider ist es oft einfach nur nervig anstrengend, sich den ständig ändernden Gegebenheiten anzupassen.
Veränderung macht oft einfach Angst.
Wenn nicht so bleibt, wie es mal war oder wie ich das gerne haben möchte, dann steht immer die große Unbekannte im Raum und verweist den Status Quo außer Hauses. Im Gepäck schleppt sie sehr häufig unangenehme Fragen an. Unbekanntes, Fremdes flößt mir manchmal Angst ein – vermutlich hängt es von den Umständen ab ob und wie breit sich das unangenehme Gefühl macht. Erstaunt habe ich vor einiger Zeit fest gestellt, daß ich mittlerweile ein sehr entspanntes Verhältnis zur Angst habe. Sie ist mir ein Warnsignal und erfüllt somit eine wichtige Funktion, doch sie ist nichts mehr was mich, manchmal bis zur Untätigkeit, lähmt. Ich mache oft Dinge, vor denen ich Angst habe. Oder vielleicht gerade deswegen? Jedes Mal gehe ich danach verändert aus diesen Herausforderungen hervor.
Ich habe selten einen wirklich ausgereiften Plan A zur Hand, geschweige denn einen Plan B, ich improvisiere mich durchs Leben. Pläne haben bei mir keine lange Halbwertszeit. Mittlerweile weiß ich, daß mir die grobe Richtung reicht, den Rest entscheide ich wenn der Zeitpunkt der Entscheidung vor mir steht. Die wenigsten Veränderungen machen mir tiefgehende Angst, es sind die wirklich großen Themen wie Verlust und Konsorten, bei denen das anders aussieht.
Veränderungen sind bei mir passiver Natur.
Darin, mich anzupassen und auf veränderte Situationen, nach einer Zeit des traurig seins, einzugehen und mich damit zu arrangieren, bin ich gut. Veränderung, die von außen kommt, stecke ich gut weg. Worin ich wirklich grottenschlecht bin, ist mich selber nachhaltig und dauerhaft zu verändern. Aktiv zu verändern. Ich bin der typische gescheiterte Neujahrsvorsatz, noch bevor der letzte Böller angezündet ist, machen sich meine Entschlüsse bereits auf den Weg in die Niederhöllen.
Dafür, daß ich mich ständig neu definiere weil meine Welt das so erfordert, muss ich wohl noch lernen, Veränderungen meines Selbst aktiv anzustoßen.
Too long, didn’t read
Am Ende des Tages stelle ich also fest, daß ich Veränderungen einfach nicht mag. Wirklich nicht mag. Sie sind nervig, sie sind anstrengend, sie lassen mich immer etwas verlieren und bei den wirklich großen Themen jagen sie mir schon mal Angst ein. Allerdings scheine ich ziemlich anpassungsfähig zu sein, wenn das Leben mich verändert. Und ich lerne bestimmt noch, mein Leben bewußt aktiv zu verändern. Bin ja erst vierzig, das wird schon.
Sie gehört zum Leben dazu, diese Veränderungskiste. Und manchmal, da finde ich sie auch spannend. Wer weiß, wohin mich das Leben die nächsten zwanzig Jahre trägt und was es noch mit mir vorhat. Ich bin lieber neugierig als ängstlich, das macht mir Veränderungen erträglicher. Vielleicht mag ich es am Ende doch, dieses „… daß nichts bleibt … daß nichts bleibt, wie es war …“ Aber sagen Sie es nicht weiter.
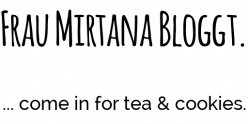
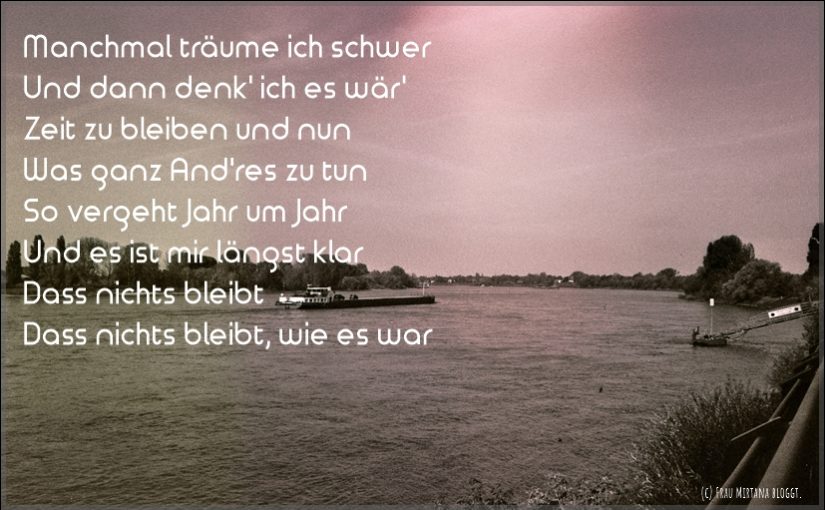
<3
😉